EU-Projekt STARTREC
 EU-Projekt STARTREC:
EU-Projekt STARTREC:
Space, domesTic and industriAl applications with impRoved TheRmoElectric Components
Ziel des STARTREC-Projekts ist es, eine neue Generation thermoelektrischer Generatoren zu entwickeln, die auf der Kombination nanostrukturierter thermoelektrischer Si85Ge15-Materialien mit innovativen Modularchitekturen basieren und deren Wirkungsgrad auf 10-15 % verdoppelt und deren Leistung für drei verschiedene, hochwirksame Anwendungsfälle demonstriert werden soll: Industrielle Abwärmerückgewinnung, Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung und Radioisotopenbatterien.
Laufzeit: 01.01.2025 – 31.12.2028

The STARTREC project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101160663

Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (Organisator)
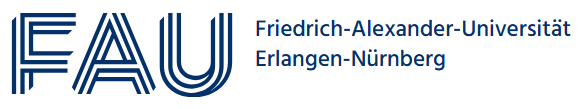
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

RGS Development
![]()
Voestalpine

K1-met

Tractebel

Centre Spatial de Liège

Ökofen
to come
Ziel von STARTREC ist die Entwicklung einer neuen Generation thermoelektrischer Generatoren (TEG), die für Anwendungen im Mittel- und Hochtemperaturbereich optimiert sind. Bei den drei Anwendungen handelt es sich um industrielle Abwärmerückgewinnung, Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung (µCHP) und Radioisotopengenerator.
Für µCHP wird eine integrierte TEG-Baugruppe entwickelt, die durch den häuslichen Heizwasserkreislauf gekühlt wird, um die Gesamteffizienz zu maximieren. Der neue TEG-Demonstrator wird in mehreren Testkesseln installiert, um die optimale TEG- und Wärmetauschergeometrie, die TEG-Position und -Temperaturen sowie die Auswirkungen unterschiedlicher Kessel- und Heizkreislastbedingungen auf die elektrische Leistung zu ermitteln. Darüber hinaus wird die Wärmeübertragung auf der heißen und kalten Seite durch Simulationen und Experimente untersucht und optimiert, um die Effizienz des Systems weiter zu steigern.
Darüber hinaus wird ein umfassendes Life cycle assessment für den Einsatz von TEGs durchgeführt, die alle relevanten Prozessschritte von der Rohstoffgewinnung bis zum Recycling bzw. zur Entsorgung umfasst. Dies wird eine kritische Bewertung der Umweltauswirkungen von TEGs im Vergleich zu konkurrierenden µCHP-Technologien ermöglichen.
Zu den erwarteten Vorteilen von TEG-µCHP gehören:
- Die Möglichkeit des netzunabhängigen Betriebs des Pelletkessels
- Geringer Wartungsaufwand, da keine beweglichen Teile im Generator vorhanden sind
- Geringere Kosten im Vergleich zu anderen µCHP-Technologien wie z. B. Stirlingmotoren
Ansprechpartner:
Department Chemie- und Bioingenieurwesen (CBI)B.Sc Niklas Hehmke, M. Sc.
Lehrstuhl für Energieverfahrenstechnik
